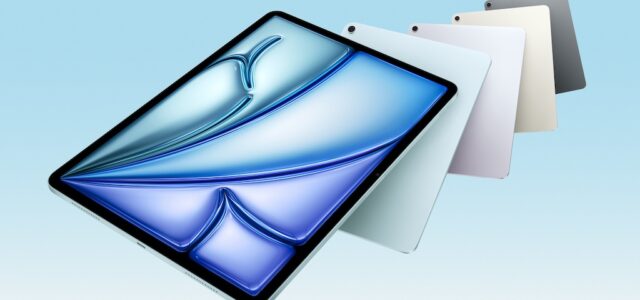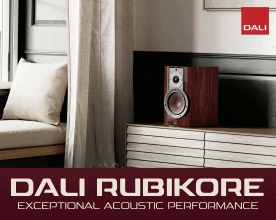Home » Heimkinopaket » EnigmAcoustics Dharma D1000 – Hybrid-Headphone der Referenzklasse
25. Mai 2016
von Volker Frech
RedakteurKopfhörer mit Elektrostat-Schallwandlern? Solche „Bändchen“ sorgen bislang vor allem bei HiFi-Lautsprechern für Traumklang, im Reich der Kopfhörer hingegen ist dieser Wandlertyp wegen der speziellen Spannungsversorgung bis heute ein Exot. Nun sprengt ein Newcomer die technischen Fesseln: EnigmAcoustics hat das Elektrostat-Prinzip erst modifiziert, dann miniaturisiert und schließlich mit einem konventionellen Wandler kombiniert – das verblüffende Ergebnis trägt einen ebenso ungewöhnlichen Namen: „Dharma D1000“.
Dharma ist die Ethik, die im Hinduismus das Leben bestimmt – was das mit einem Kopfhörer zu tun hat, ist bislang ein Rätsel. Das passt prima zu einem Hersteller, der sich „EnigmAcoustics“ nennt. Das Rätsel um die Firma ist aber schnell gelöst: Das kalifornische Unternehmen gibt es seit knapp sechs Jahren, es hat mit seinen Präsentationen schon auf diversen Messen für Aufsehen gesorgt, doch erst 2015 ist die Marke weltweit in den „personal audio market“ eingestiegen, das Debüt war die Münchener „High End“.
Schlüsseltechnologie
EnigmAcoustics hat sich der Elektrostat-Schallwandlertechnik und dem Antrieb solcher Flächenstrahler verschrieben, die Kalifornier haben mehrere Jahre an ihrer Schlüsseltechnologie „SBESL“ gefeilt: Elektrostaten, die ohne die übliche aufwändige Spannungsversorgung funktionieren. Darauf kommen wir später noch einmal zurück. Vollbereichslautsprecher sind mit dieser Technik (noch?) nicht möglich, deshalb hat EnigmAcoustics einen kleinen Elektrostaten präsentiert, der als „Super Tweeter“ ausschließlich im hohen Frequenzbereich arbeitet. Dieser externe Höchst-Töner soll mit schon existierenden konventionellen Lautsprecherboxen kombiniert werden und aus dem Musiksignal jene Räumlichkeit, Dynamik und höherfrequenten Informationen herausholen, die nach Meinung der Kalifornier von den „normalen“ elektrodynamischen Schallwandlern nicht wiedergegeben werden. Mittlerweile bietet EnigmAcoustics auch einen eigenen konventionellen Lautsprecher als Spielpartner für diesen Super Tweeter an.
Mit dem Dharma D1000 haben die Kalifornier diese Kombination nun auf Kopfhörergröße geschrumpft. Diese neue Art der Musikwiedergabe wollten wir uns doch mal durch den Kopf gehen lassen, da passt es prima, dass die Amerikaner seit kurzem einen deutschen Vertrieb (audioNEXT in Essen) haben. Also: Her mit dem Hörer!
Die Enthüllung
Der Dharma ist kein kostengünstiges Vergnügen, er schlägt in Europa mit knapp 1.600 Euro zu Buche. Dafür darf man schon eine ausgezeichnete Qualität erwarten – und die wird geliefert. Der Nobel-Kopfhörer kommt in einer edel gestalteten Verpackung, zu seinem sicheren Transport liegt er in einer mattschwarzen Box aus hochstabilem Karton. Nein, keine Holzschatulle, wie sie bei diversen Konkurrenten beliebt ist, auf eine solch luxuriös-kostenintensive Umverpackung verzichten die Kalifornier. Enthüllen wir den Hörer: Öffnet man die Box, so sieht man seinen neuen Tongeber in einem passgenau zugeschnittenen Schaumstoffbett liegen, das mit schwarzem Kunstsamt überzogen ist. In einem separaten Fach liegt eine Schachtel, sie beinhaltet das mitgelieferte Kabel und einen Klinkenstecker-Adapter, zum Zubehör gehört noch eine in Englisch verfasste Bedienungsanleitung. Uns interessiert aber natürlich erst einmal der Kopfhörer – und hier starten wir mit der „Haltungsnote“: Wie hält sich der Dharma auf dem Haupt?
Der Dharma D1000 verschwindet: Komfort und Konstruktion

[/vc_column_text]
Offen für luftigen Klang
Es wird schnell klar: In diesem Kopfhörer steckt eine Menge drin – und wir holen jetzt alles heraus. Fangen wir mit der Bauform an: Der Dharma D1000 ist vom Prinzip her ein „offener“ Kopfhörer, er schirmt die Ohren also nicht gegen die Umweltgeräusche ab, sondern ist schalldurchlässig, dafür sorgt Perforation der Muscheln. Damit ist er weniger für den mobilen Einsatz auf der Straße gedacht, sondern eher für das stationäre Hören im ruhigeren Zuhause. Durch seine elektrischen Werte ist der Dharma aber durchaus straßentauglich, möglich machen das seine niedrige Impedanz und sein guter Kennschalldruck: Mit gerade mal 26 Ohm und 103 dB ist er auch für mobile Abspielgeräte geeignet, man muss sich natürlich fragen, ob es Sinn macht, einen solchen Referenzhörer mit einem klanglich minderbemittelten Smartphone zu betreiben, da wäre schon ein audiophiler DAP (Digital Audio Player) wie der Calyx M ein angemessener Musiklieferant.
Zurück zur offenen Bauweise: Die Durchlässigkeit hat neben den anfangs genannten klimatischen Vorzügen auch akustische Vorteile. Offene Kopfhörer sind frei von jenen klangverfälschenden Resonanzen, die bei geschlossenen Modellen zum Problem werden können. Auch der Luftwiderstand ist kleiner: Liegt die Luft bei geschlossenen Kopfhörern wie ein Polster vor der Membran und bremst deren Bewegung ab, so ist dieser abfedernde Effekt bei offenen Kopfhörern geringer, weil die Luft entweichen kann. Die Membran kann also mit weniger Kraftaufwand agieren und freier schwingen. Deshalb liefern offene Kopfhörer ein Klangbild, das freier und luftiger wirkt als die eher kompakt klingende Wiedergabe von geschlossenen Modellen.
Exot in der Muschel: Der Elektrostat
Der geringe Luftwiderstand begünstigt ein Lausprechersystem, das von der Feinheit seines Schallwandlers lebt: den Elektrostaten. Dies ist eine ganz ausgebuffte Art der Klangerzeugung, sie funktioniert so: Die Membran besteht aus einer hauchdünne Folie, die über ihre ganze Fläche mit einer elektrisch leitfähigen Schicht überzogen ist. Diese Folie befindet sich zwischen zwei sogenannten Statoren, das sind perforierte Metallplatten. Nun setzt man die Folie unter eine beständige Spannung, diese Vorspannung nennt man „Polarisierungs-Spannung“ oder „Bias“, hiermit erzeugt man ein permanentes elektrisches Feld. An den Statoren hingegen liegt als Spannung das elektrische Audiosignal an. Mit der sich ständig ändernden Audiosignal-Spannung wird nun die Folie angezogen und abgestoßen – also: zum Schwingen gebracht. Und weil die Folie so hauchdünn, ist, schwingt sie flott und agil, also nahezu ideal.
Dieses tolle Prinzip hat allerdings gravierende Nachteile: Es ist aufwändig in der Fertigung und damit teuer, und die benötigten Spannungen sind so hoch, dass solche Kopfhörer mit speziellen Verstärkern betrieben werden müssen, welche solche Voltzahlen liefern können. Deshalb gehören Elektrostaten zu den Exoten im Reich der Kopfhörer. Nun ist es EnigmAcoustics gelungen, einen Elektrostaten zu bauen, der ohne externes Netzteil auskommt. Die Kalifornier haben sich ihre Erfindung unter dem Namen „SBESL“ patentieren lassen, das Kürzel steht für „Self Biased Electrostatic“ – und das wiederum soll bedeuten: Die Membran wird nicht mehr mit einer ständig zugeführten hohen Polarisierungs-Spannung (Bias) versorgt, stattdessen besitzt die Folie eine eigene, beständige statische Ladung. Die ist aber so klein, dass der Elektrostat auch in seiner Miniaturisierung für den Kopfhörer nicht die Kraft hat, um als alleiniger Lautsprecher aufzutreten – und deshalb hat EnigmAcoustics ihm einen Mitarbeiter unter die Muschel gesteckt.
Der Hybridantrieb: 1 + 1 = 1
Zum Elektrostaten gesellt sich ein elektrodynamischer Schallwandler, also ein konventioneller Lautsprecher, der seine Membran über eine Schwingspule und einen Permanentmagneten in Bewegung setzt. Doch auch dieser Wandler erweist sich als Exot: Seine 52-Millimeter-Mebran besteht aus Wagami, das ist ein extrem leichtes und zartes Papier aus dem Fernen Osten, viele werden es als handgeschöpftes „Japan-Papier“ kennen. Dieser Wagami-Wandler sitzt zentral in der Muschel des Dharma, seitlich von dem Konus-Treiber (und ihn teilweise verdeckend) ist dann der Elektrostat in einem eigenen geschlossenen Gehäuse positioniert, von dieser Randlage aus strahlt er auf die menschliche Ohrmuschel, allerdings nicht direkt in den Gehörgang. Das ist nun schon mechanisch eine bemerkenswerte Konstruktion, und noch beachtlicher ist das elektrische Zusammenwirken dieser beiden Treiber: Während der konventionelle Konus den Schall ab fünf Hz wandeln soll und ohne Begrenzung als Vollbereichs-Lautsprecher arbeitet, ist der Elektrostat als Unterstützung ab etwa 12 Kilohertz aufwärts tätig, das Wandelvermögen dieses Höchst-Töners reicht angeblich bis 40 Kilohertz. Beide Lautsprecher arbeiten also partiell parallel. Dieser Hybridantrieb soll nun das Beste aus beiden Welten bieten: Die Kraft, Dynamik und Sonorität des Elektrodynamikers sowie die Transparenz, Klarheit und Räumlichkeit des Elektrostaten. Und dabei soll dieser Doppel-Antrieb wie aus einem Guss agieren, als schallwandelnde Einheit.
Dharma D1000 am Kabel
Ein Extra-Kapitel für ein Kabel? Ja, denn hier geht es nicht um eine schnöde Strippe zwischen Kopfhörer und Verstärker, sondern um einen wesentlichen Bestandteil der Klangkette: Die Qualitäten und Eigenschaften des Kabels sind für den Hörspaß mitentscheidend. Zum Dharma D1000 wird ein sehr hochwertiges Kabel mitgeliefert, es entspricht jenem Modell, das ein äußerst bekannter Hersteller aus dem Raum Hannover seinem Referenz-Hörer beigibt. Das Anschlusskabel ist beidseitig geführt, das heißt, es wird je ein Stecker an eine Ohrmuschel angeschlossen. Das ist auch gut so, denn das Kabel wiegt satte 124 Gramm. Dieses Gewicht möchte man doch lieber auf beide Muscheln verteilt haben, statt die Zugkraft nur auf einer Seite zu spüren. Und das klappt gut, beim Tragen spürt man keine Belastung durch das Kabel. Das hohe Gewicht erklärt sich aus seiner Länge und Güte: Die Verbindung zum Verstärker erlaubt dem Kopfhörerträger einen Aktionsradius von über drei Meter, mitsamt der schwarzen Textilummantelung besitzt das Kabel einen beachtenswerten Querschnitt von 6 Millimeter. Durch den Materialmix und die Isolation reagiert es vorzüglich auf mechanische Einflüsse, es ist äußerst unempfindlich gegen Berührung, also kaum mikrofonisch – das ist ein großes Plus, denn gerade die tieffrequenten Geräusche berührungsempfindlicher Kabel stören den Musikgenuss ungemein.
Zum Gewicht des Kabels tragen auch die überraschend schweren Metallstecker bei, die am Kopfhörer angeschlossen werden. Es sind zweipolige Mini-Stecker mit vergoldeten Kontakten. Diese massiven Stecker anzuschließen und das satte „Klick“ beim Einrasten zu hören, ist ein Erlebnis für sich. Dank der Führungsnasen kann man die Stecker nicht falsch gepolt einschieben, und durch das Einrasten sind die Stecker gegen unabsichtliches Herausziehen gefeit, da muss man schon ein wenig Kraft aufwenden, um sie wieder herauszuziehen. Ein unabsichtliches Herausreißen ist damit sehr unwahrscheinlich. Trotz dieser stabilen Verbindung haben die Stecker in der Buchse überraschenderweise ein wenig Spiel, dadurch wackeln sie leicht, wenn das Kabel bewegt wird, etwa beim Drehen des Kopfes. Dieses Wackeln ist zwischenzeitlich hörbar. Nun ist dieser Kopfhörer weniger für den aktivitätsreichen Einsatz auf der Straße konzipiert, und beim heimischen Hören hält sich die Kopf- und Körperbewegung üblicherweise in engen Grenzen. Deshalb stört die Geräuschentwicklung den Musikgenuss nur selten. Trotzdem: Dieser Punkt hat Potenzial für eine Verbesserung.
Das Kabel mündet auf der anderen Seite in einen 6,35mm- Klinkenstecker, auch hier sind die Kontaktfächen vergoldet, der Stecker ist hingegen aus leichtem Aluminium – eine gute Wahl, denn das reduziert das Gewicht, das letztlich auf der Kopfhörerbuchse lastet.
Zu dem Kabel wird ein vergoldeter Miniklinke-Adapter mitgeliefert. Das ist sinnvoll, denn selbst etwas höherpreisige Verstärker weisen, wenn sie überhaupt einen Kopfhörereingang haben, mitunter eine 3,5mm-Buchse auf. Andererseits ist die Stecker-/Adapterkonstruktion insgesamt elf Zentimeter lang, das stellt für die Buchse eine starke mechanische Beanspruchung dar, dazu kommt die Gefahr, an diesem langen Stecker hängen zu bleiben. Hier muss man pfiffig sein und sich eine Lösung einfallen lassen, die die Buchse entlastet.
Im Kosmos der Klänge: eine akustische Erlebnisreise
Einem hochwertigen Kopfhörer wie dem Dharma sollte man einen würdigen Spielpartner geben, wir haben dafür den „Conductor Virtuoso“ von Burson gewählt, eine ausgezeichneter Kopfhörer-Verstärker/Pre-Amp mit integriertem DAC. Den Digital/Analog-Wandler brauchen wir auch gleich für die HiResolution-Files vom Computer, wir starten mit „Seattle“ von Mark Knopflers siebtem Solo-Album „Privateering“ – eine herrlich wehmütige Ballade, die beim Hören für eine wohlige Melancholie sorgt, aber auch für eine erste Gänsehaut: Gleich nach dem leisen Akkordeon-Akkord setzt mit der Akustikgitarre das Schlagzeug ein, Drummer Ian Thomas streicht mit dem Besen ganz zart über die Snare – und dieses akustische Detail gerät mit dem Dharma zum Erlebnis! Dieses sanfte Reiben und Rauschen ist nicht überbetont, sondern hyperdeutlich, das ist großartig herausgearbeitet! Die Stelle haben wir uns noch ein paar Male angehört, weil sie so schön ist. Zumal nun über dem Streicherteppich des Keyboards eine herrlich perlende, klare Gitarre einsetzt, mit einem wunderbar runden, trotzdem leicht drahtigen Ton. Die leichten Rutschgeräusche auf den Saiten sind derart crisp, dass man meinen könnte, das Ohr direkt an Knopflers Gitarre zu haben. Auch dieses subtile Geräusch ist ein echter Nackenhaar-Aufsteller. Der Dharma verschiebt damit aber nicht die räumlichen Verhältnisse der Aufnahme, Herr Knopfler hat seine Gitarren bei der vorzüglichen Produktion halt sehr prominent abgemischt.
Natürlich steht auch seine Stimme im Vordergrund, aber der Herr mit der nöligen Stimme klingt nun, als habe er endlich mal die Nase ein wenig frei bekommen. Nicht anders, aber etwas offener wirkt sein Gesang. Und auch hier beeindrucken wieder die Nuancen, leicht reibend angesetzte Töne, der plötzlich anwachsende Bass im Organ, wenn Knopfler Töne im tiefen Register singt, das Hauchen am Ende der Worte – diese unheimliche Klarheit und Detailfreudigkeit, die der Dharma liefert, ist schlicht grandios. Das Spektrum wirkt nun „vollständig“, die Wiedergabe ist dabei bruchlos und integer; man hört zu keiner Zeit, dass hier zwei verschiedene Systeme – Elektrodynamik und Elektrostatik – parallel arbeiten.
Den Detailreichtum testen wir nun noch mit einer markanten Stelle, dem Ende von „Redbud Tree“, dem Opener dieses Albums: Wo ein beileibe nicht preiswerter Vergleichskopfhörer das feine Rauschen, das diese Aufnahme umgibt, eher wie eine Rauschfahne wirken lässt, die sich am Ende beim Ausklingen der Instrumente in den Vordergrund drängelt, da zeigt der Dharma, dass dieses Rauschen schlicht zum Charakter der gesamten Aufnahme gehört, zu der Art, wie die empfindlichen Mikrofone in Knopflers Studio die intime Besetzung von Gesang, Akustikgitarre, Akkordeon, Bass und seht dezentem Schlagzeug eingefangen haben. Bei aller Intimität haben die Musiker aber den gebührenden Abstand voneinander, der Dharma drängt sie nicht zusammen, das Klangbild ist sehr offen. Und es ist überaus entspannt und unspektakulär. Beim Test haben wir immer wieder ein bisschen lauter gemacht, um bei diversen Stellen noch einmal genau hinzuhören. Mit dem Dharma fällt die Einsicht schwer, dass man irgendwann mal wieder das Volumenrad nach links drehen sollte. Hier nervt halt auch bei hoher Lautstärke einfach nichts. Man kann sich in der Musik verlieren, gerade mit ruhigeren Songs à la Knopfler klinkt man sich aus dem hektischen Heute aus und genießt entschleunigt, mit Ruhe.
Zu dieser Ruhe trägt auch die souveräne Tiefton-Wiedergabe bei. Die bassreiche Akustikgitarre des Knopfler-Albums, die schon über Lautsprecherboxen auffällig war, kommt mit einem Tieftonvolumen aus den Muscheln, das nun wirklich keinen Wunsch nach Mehr offenlässt. Für ungezügelte Urgewalten ist der Kopfhörer aber nicht zu haben: „Rapture“, ein World Trance-Stück der persischen Sängerin Mamak Khadem, wird von wuchtigen Trommeln getrieben, der Dharma gibt sie satt, aber sehr kontrolliert wieder, er erlaubt ihnen keine klangliche Dominanz, sondern gibt ihnen eine gebührende räumliche Präsenz. Mit seiner phänomenalen Abbildung glänzt der Kopfhörer bei sämtlichen Aufnahmen – und hiervon profitieren natürlich besonders Orchesteraufnahmen. Die Weltklasse-Geigerin Lisa Batiashvili hat zusammen mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen Beethovens Violinkonzert eingespielt, diese Aufnahme besitzt eine tolle akustische Tiefe, die lässt uns der Dharma regelrecht spüren. Die Darstellung der Bühne wirkt nahezu holografisch: Da steht eine Geigerin aus echtem Fleisch und Blut wenige Meter vor uns, sie bringt eine sündhaft teure Stradivari zum Singen, wir hören hier jeden feinen Strich ihres Bogens. Und dann übernimmt das Orchester im Tutti, es ist ein wirklicher „Klangkörper“, die einzelnen Instrumentengruppen sind wunderbar im Gesamtklang auszumachen und zu orten. Magisch ist dann der Moment, in dem Batiashvili das quer durch das kleine Orchester wandernde Motiv wieder auf ihrer Solo-Geige aufgreift. Dem Dharma gelingt also nicht nur eine sehr räumliche Darstellung, sondern auch eine außerordentliche Transparenz. Das erleben wir ebenso mit einer Musik, die für den Genuss unter Muscheln wie geschaffen ist: „Oh Yeah“, der Electronica-Klassiker der Klangtüftler „Yello“. Der 2009er-Remix des Songs ist ein Fest der Frequenzen, Sounds und Effekte, und mit dem Dharma sind wir bei der Feier dabei: Es ist schlichtweg verblüffend, was in diesen zweieinhalb Minuten an Soundeindrücken und Details auf uns einprasselt. Das beginnt beim einleitenden Vogelgezwitscher, in das wir wie durch einen akustischen Zoom geraten, es wird zu einer ornithologischen Erkundung – war dieser schnarrende Balzruf ganz im Hintergrund wirklich schon immer da? Und dann kommt dieses unglaublich präsente Gelächter von Boris Blank, es wird einem fast unheimlich, wie nah dieser Mann auf einmal vor uns steht! Mit dem gnadenlosen „Oh Yeah“ starten Yello nun ihre effektreiche Elektronica-Show, gleich die grundlegenden Synthie-Melodie haben wir so herausgemeißelt noch nicht gehört. Die Töne sind keinesfalls glatt poliert, es wirkt eher so, als wären sie von ihren Ausfransungen am Rand befreit und besäßen nun eine klare Kante. Klarer wird nun auch so manche Raumstruktur: Zwischenzeitlich sind fiese Geräusche eingestreut, die das Hi-Hat-Becken des Schlagzeug überlagern, an den Reflexionen hört man deutlich, dass Yello uns in einen kleinen, kahlen Raum gesteckt haben, man sieht fast die Fliesen in diesem fiesen akustischen Szenario! Mit dem Dharma wird in aller Konsequenz klar, mit welchen akustischen Finessen Yello diese Produktion versehen haben.
Insgesamt macht der Dharma D1000 aber noch andere Konsequenzen klar: Zum einen lässt er an schlechten Aufnahmen oder komprimierten Files kein gutes Haar, das gehört zur Natürlichkeit, besser: zur Ehrlichkeit dazu. Darüber hinaus macht der Dharma nicht mit jedem Verstärker uneingeschränkt glücklich; wir haben den Kopfhörer auch über den Eingang eines sehr hochwertigen Vollverstärkers gehört, da wurde unsere Begeisterung ein klein wenig gedämpft – hier muss man also schlicht ausprobieren, ob der Dharma zur eigenen Elektronik passt.
Fazit
Der Dharma D1000 ist schlicht herausragend. Er bietet einen unglaublichen Detailreichtum, eine sehr gute Dynamik und eine exzellente Räumlichkeit. Stimmen und Instrumente wirken außerordentlich artikuliert, aber nichts ist überbetont – und in dieser Natürlichkeit, Entspanntheit und Selbstverständlichkeit liegt das Sensationelle seiner Schallwandlung. Der Dharma D1000 ist sicher nicht günstig, aber er ist im wahrsten Sinn des Wortes preiswert: Mit diesem ausgezeichnet verarbeiteten Kopfhörer darf man sich auf viele Jahre High-End-Hörspaß freuen. Die kostbaren Momente werden dadurch erschwinglich.
Test & Text: Volker Frech
Fotos: www.lite-magazin.de
Klasse: Referenzklasse
Preis-/Leistung: angemessen
100 of 100
95 of 100
95 of 100

Technische Daten
| Modell: | ENIGMAcoustics Dharma D1000 |
|---|---|
| Produktkategorie: | Kopfhörer |
| Preis: | 1595,00 Euro |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Ausführungen: | - schwarz |
| Vertrieb: | audioNEXT, Essen Tel.: 0201 / 507 3950 www.audionext.de |
| Gewicht: | - 0,461 kg (ohne Kabel) - 0,521 kg (mit Kabel) |
| Prinzip: | - offene Bauweise - ohrumschließend - hybrides dynamisch-elektrostatisches 2-Wege-System |
| Treiber: | - Hochtöner: Elektrostat - Mitteltieftöner: dynamisch, 52 mm-Wagami-Papiermembran |
| Impedanz: | 26 Ohm |
| Frequenzbereich: | 5 Hz - 40 kHz (Herstellerangabe) |
| Anschluss: | Kabel (beidseitig geführt, abnehmbar) |
| Zubehör: | - 1 Kabel (6,35 mm Klinke, Länge:3 m) - Adapter 6,35 mm/3,5mm - Bedienungsanleitung (englisch) - Transportkarton (schaumstoffgepolstert) |
| Besonderes: | - feinstauflösender Klang - hybrider Antrieb (dynamisch/elektrostatisch) - sehr gute Verarbeitung - hoher Tragekomfort - Stecker des Kabel haben in den Kopfhörerbuchsen etwas Spiel |
| Benotung: | |
| Klang (60%): | 1+ |
| Praxis (20%): | 1,0 |
| Ausstattung (20%): | 1,0 |
| Gesamtnote: | 1+ |
| Klasse: | Referenzklasse |
| Preis-/Leistung | angemessen |
-
Cayin iHA-6 – Schicker Kopfhörer-Verstärker für audiophilen Musikgenuss
-
MrSpeakers Ether 2 – Ultraleichter Magnetostat-Kopfhörer mit verblüffender Klangregelung
-
Kopfhörer-Verstärker Cayin HA-6A – Glimmende Röhren für glänzenden Klang
-
Cyrus Soundkey – der federleichte Smartphone-Klangverbesserer
-
Kopfhörer-Verstärker SPL Phonitor xe – Mit der Matrix zum natürlichen Musikgenuss